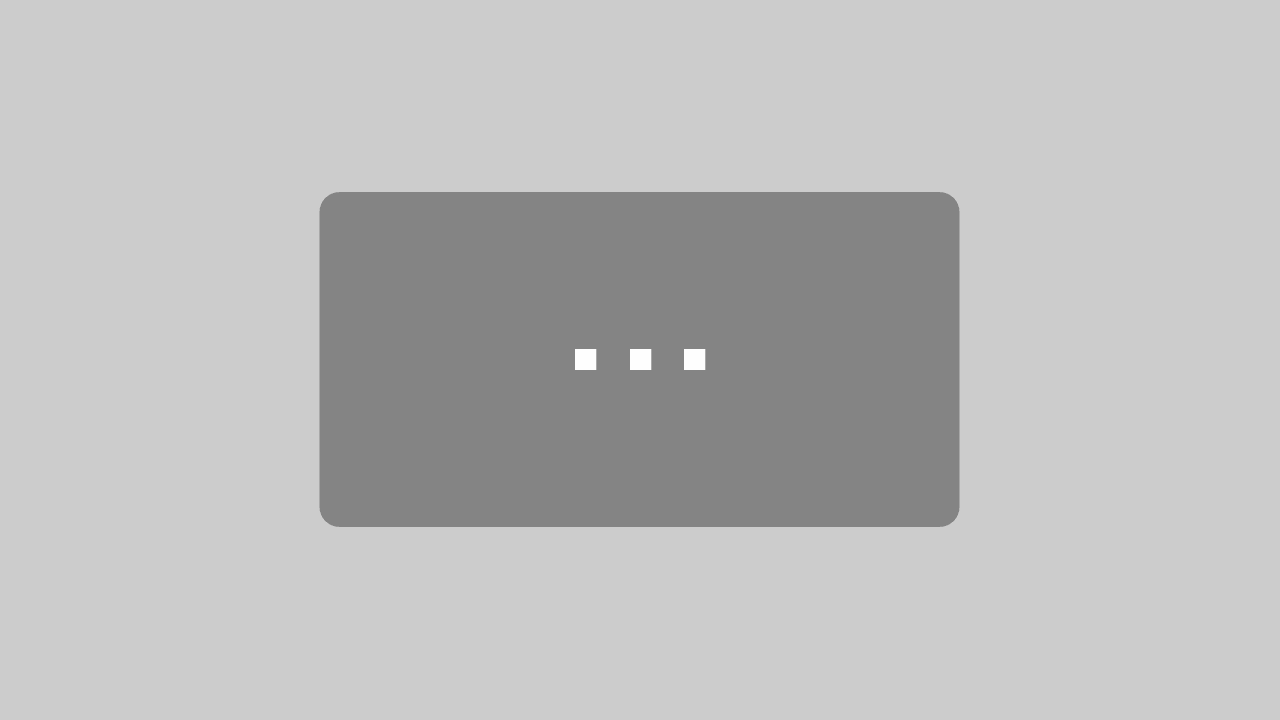Die Film- und Serienlandschaft ist von Superhelden geradezu übersättigt. Das Problem: Charakterzeichnungen und Handlungsstränge nach Schema-F machen die Filme zu einem Einheitsbrei, der zunächst leicht verdaulich, bei übermäßigem Genuss aber wie ein Klumpen im Magen sitzt. „The Boys“ – von Erik Kripke für Amazon produziert, basierend auf dem gleichnamigen Comic von Garth Ennis und Darick Robertson – reißt den müden Zuschauer brutal aus dem Film-Fresskoma. Er konfrontiert ihn mit der unangenehmen Frage: „Was, wenn unsere Superhelden nicht so super sind, wie wir es annehmen?“.
Der böse Zwilling der Justice Leage
Aus der Masse an Durchschnittsmenschen, die die Welt von „The Boys“ bevölkern, stechen einige wenige hervor: die Superhelden, genannt „Supes“. Laut eigener Aussage von Gott persönlich mit übernatürlichen Kräften gesegnet, nutzen sie diese zur Bekämpfung des Bösen. Dafür werden sie von der Bevölkerung verehrt und gefeiert wie Stars, inklusive Merchandise, Spielfilmen und werbewirksamen Öffentlichkeitsauftritten. Der Helden-Hauptkader „The Seven“ ist ein Team aus Superhelden, die vom Großkonzert „Vaught“ gemanagt und vermarktet werden. Die „Supes“ erinnern dabei in ihrem Konzept an Aldi-Eigenmarken, die dem Original – in diesem Fall altbekannten Klassikern wie Superman, Wonderwoman und co. – unverschämt ähnlich sind. Da gibt es beispielsweise den Homelander, einen blonden Schönling mit markantem Kinn, dessen blau-weiß-rotes Outfit eine Hommage an die amerikanische Flagge ist. Oder Queen Maeve, selbstbewusst und kugelsicher in einem freizügigen Kostüm, das wie eine Mischung aus Badeanzug und Brustplatte anmutet. Neuzugang ist die naive Starlight, die entschlossen ist, einen Beitrag zur Verbesserung der Welt zu leisten.
Doch ganz so einfach ist das natürlich nicht. Schnell wird ihr und dem Zuschauer klar: die Sieben scheinen viel weniger Energie auf das Retten von Unschuldigen und das Dingfestmachen von Verbrechern aufzuwenden, als auf den Ausbau ihres Ruhms und ihrer Macht. Jeder öffentliche Auftritt ist perfekt durchchoreografiert. Einsätze werden in der Vaught-Zentrale fast vollständig vorgeplant und erfordern lediglich die Vollendung durch den Helden, natürlich vor einem gut ausgestatteten Kamerateam. Hinter den Kulissen des „Supe“-Teams herrschen jedoch Intrigen, Neid und Missgunst. Drohungen, sexuelle Belästigung und Nötigung sind an der Tagesordnung.
Als durch die Unachtsamkeit des superschnellen „Seven“-Mitglieds A-Train die Freundin von Normalbürger Hughie Campbell ums Leben kommt, wird eine Kette von Ereignissen losgetreten, durch die der Einfluss der Helden ins Wanken gerät. Hughie, der von „Vaught“ mit einer halbherzigen Entschuldigung abgespeist wird, hadert damit, den Vorfall auf sich beruhen zu lassen. Immer mehr verfällt er dem Gedanken, Rache zu nehmen und die zwielichtigen Machenschaften der Superhelden aufzudecken. Gemeinsam mit dem mürrischen Engländer Billy Butcher, dem peniblen Mother‘s Milk und Frenchie, der so zurückhaltend wie brutal sein kann, sagt er den Superhelden den Kampf an. Eben noch ein vom Leben gelangweilter Elektronikmarktangestellter, findet Hughie sich nun auf der Jagd nach den „Supes“ wieder und realisiert langsam, dass er sich in eine Situation manövriert, die er deutlich unterschätzt hat.
Zwischen Gesellschaftskritik und Pop-Kultur
Ganz neu ist das Konzept der subversiven Superheldengeschichte nicht. Der Marvel-Kinokassenschlager „Deadpool“ versuchte bereits, das Genre ironisch aufzuarbeiten und mit Witzen auf eigene Kosten zu punkten. Letztendlich wurden aber auch hier alle 08/15 Heldenfilm-Klischees bedient. Es gab eine Romanze, einen charmanten Hauptcharakter und den Kampf von Gut gegen Böse. Nur halt mit mehr Blut und derbem Humor. „The Boys“ hat einen ganz eigenen Ansatz, der sich am ehesten mit den „Watchmen“, im Comic-Original von Alan Moore und Dave Gibbons, vergleichen lässt. Die Serie kritisiert den Heldenkult um Stars und Sternchen und damit auch den um Studios wie Marvel und DC. Die Serie zeigt auf, was der Zuschauer zwischen dem Hype um den neusten Trailer und der Bewunderung beliebter Schauspieler gerne vergisst: Auch diese Studios sind letztendlich profitorientierte Konzerne wie alle anderen.
Mit einer guten Portion beißendem Sarkasmus, schwarzem Humor und roher Ehrlichkeit zeichnet „The Boys“ ein Heldenbild, dass vor allem eines ist: menschlich. Keiner der „Supes“ ist ein Karikatur-Bösewicht, die Gut-gegen-Böse-Formel wurde nicht einfach umgekehrt. Vielmehr sind die Charaktere vielschichtig gezeichnet, variieren in ihren Moralvorstellungen und Weltanschauungen. So sind auch die Charaktere, mit denen der Zuschauer sympathisiert, nicht vor Missgriffen und Fehlentscheidungen gefeit. Genau das macht die Serie so spannend: auch wenn dem Zuschauer die Handlungen der Charaktere nicht immer gefallen, so kann er sie zumindest verstehen. „The Boys“ greift nicht nur den Superheldenfilm als Genre an und zerfleischt ihn in blutigen, nicht jugendfreien Szenen, sondern hinterfragt die Werte, die der typische DC oder Marvel Helden-Blockbuster vertritt. Gespickt mit cleverer – wenn auch nicht unbedingt subtiler – Religions- und Medienkritik trifft die Serie punktgenau den Zeitgeist.